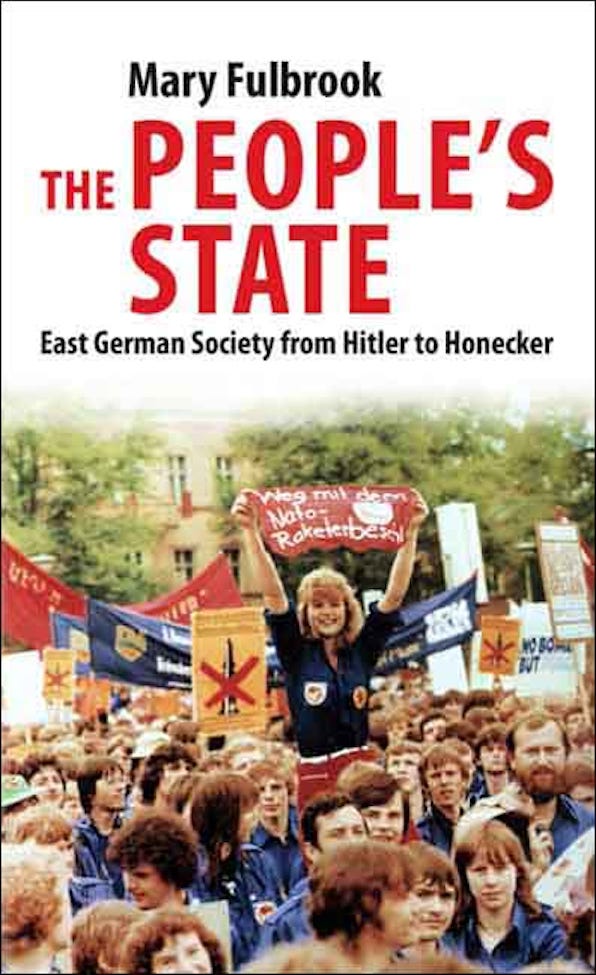Seit einigen Wochen ist von einer „neuen Ost-Debatte“ die Rede, die sich um eine Reihe neuer Bücher über die Nachwirkungen der DDR dreht. Dabei ist etwa Dirk Oschmanns Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung nicht der ‚neue Sarrazin‘, kann nicht an den bundesdeutschen Erfolg des kulturpessimistischen Deutschland schafft sich ab von 2010 anknüpfen, sondern es handelt sich bei dem Buch um einen genuinen Regionalbestseller. Der Osten generiert seine Verkäufe zu zwei Dritteln in den neuen Bundesländern und der Autor selbst hat vor allem vor einem ostdeutschen Publikum Erfolg. Lesungen Oschmanns haben Eventcharakter; Kritiker lässt Oschmann entweder von seinen anwesenden Leser:innen ausbuhen oder kritische Diskussionen werden gleich ganz abgesagt.
Oschmann, Hoyer und die Suche nach der gemeinsamen Erzählung
Oschmanns Buch ist Teil einer sich als ‚gesamtostdeutsch‘ verstehenden Opfererzählung. Oschmann beschreibt Ostdeutsche als Opfer eines westdeutschen Kolonialismus und erklärt sie damit zur marginalisierten Gruppe unter anderen. In seiner Konstruktion des ostdeutschen ‚Wir‘ klammert Oschmann zugleich aber tatsächliche Gewalt gegen marginalisierte rassifizierte Gruppen in Ostdeutschland aus. Weitere offenkundige soziale Verwerfungen – generationelle, klassenpolitische, geschlechtliche – innerhalb der ostdeutschen (Nachwende-)gesellschaft werden ebenfalls übergangen. Oschmanns Osterzählung ist ein Kompilat aus passenden Statistiken und Anekdoten, die jeweils Gefühle von Ausschluss und Marginalisierung auslösen. Es ist das identitätsstiftende Potenzial dieser emotionsgeladenen Erzählung, das Oschmanns Buch zum Bestseller macht, wenngleich der Autor jegliche eigenen essenzialisierenden Absichten mit Verweisen auf die „westdeutsche Erfindung“ des Ostens von sich weist.
Es überrascht folglich nicht, dass für und als Teil dieser Erzählung nach historischer Legitimation gesucht wird. Da kommt die deutsche Übersetzung der zuerst in England erschienenen DDR-Geschichte von Katja Hoyer gerade richtig. Was als „neue Geschichte“ für das deutsche Publikum tituliert wird, knüpft allerdings an die ältere und nicht unumstrittene angloamerikanische Geschichtsschreibung zur DDR an. Die britische Historikerin Mary Fulbrook etwa schrieb 2005 über das „ganz normale Leben“ in der DDR (Originaltitel: The People’s State. East German Society from Hitler to Honecker). Nach Fulbrooks Deutung handelte es sich bei der DDR um eine „partizipatorische Diktatur“, die zum Teil auf Zustimmung beruhte und ihren Subjekten Handlungsspielräume bot, was für Fulbrook heute manche DDR-Nostalgie erklären könnte. Fulbrook kritisierte damit totalitarismustheoretische Gleichsetzungen von DDR und NS-Staat und stieß zur damaligen Zeit nicht auf dieselbe populäre Resonanz wie Hoyer heute.
Autofiktion, 1968 und 1989
Obwohl Fulbrook bei Hoyer kaum zitiert wird und ihr sozialhistorisches Buch an sich erstaunlich theoriearm ist, folgt auch Hoyer implizit dieser bekannten These: „East Germans were finding ways to live with a regime that permanently oscillated between the need for popularity and the need to control.“ Während Fulbrook jedoch für die vergleichsweise „Normalität“ des Lebens in der DDR als spätindustriellem Land argumentiert, bricht Hoyer sprachlich und anekdotisch eine Lanze für die sich aus ihrer Geschichte ergebende kulturelle Besonderheit der DDR. Beispielsweise: „Many [...] East Germans have very fond memories of the 1974 World Cup. The little GDR won its group even though it included the West German hosts who had by then built a fearsome reputation [meine Hervorhebung] as a football team.“ So hätten auch zeitgenössische Literaten wie Christa Wolf künstlerisch von der sozialpolitischen Alternative, die die DDR bot, profitiert, bis sie von ihrem Autoritarismus erdrückt worden waren: „Talented creative minds like hers were stifled by a regime too blinkered by its own paranoia to trust the people who had chosen to live and work within its rules.“
Meiner Vermutung nach ist es gerade diese Annahme eines ostdeutschen Exzeptionalismus, der Ostdeutsche wahlweise als diktaturerfahren und damit politisch besonders mündig oder als einzigartig kultiviert setzt, der heute sowohl an kulturkonservative als auch an rechtspopulistische Diskurse anknüpfungsfähig ist. Während Fulbrook sich dabei auf eigene Archivrecherchen bezog, arbeitet Hoyer im Sinne einer oral history überwiegend anhand von Interviews mit Zeitzeugen. Und während Oschmann dem ‚kollektiven Osten‘ in der Nachwendezeit bis heute Freiheit abspricht, wertet Hoyer Erinnerungen an die DDR-Zeit positiv auf, indem sie Ostdeutschen Möglichkeiten zur individuellen Selbstentfaltung zuspricht: Täter-Opfer-Schema danach, agency davor. Allgemein wird Erinnerung als Zugriff zur DDR-Vergangenheit historische Legitimität zugesprochen, auf dieselbe Weise, in der Oschmann seine eigenen Erinnerungen an die DDR als letztlich bedroht von westdeutschen Perspektiven darstellt.
Diesem ostdeutschen ‚Wir‘ begegnen mehrere ostdeutsche Autor:innen aus fiktionalisierten Ich-Perspektiven mit eigenen Erinnerungen an die Nachwendejahre. Oschmanns ostdeutsche Misserfolgs- und Kolonisierungsgeschichte wird umgeschrieben in eine Gewaltgeschichte, die Machtverhältnisse im Osten hinterfragt. So erlebt der deutsche Osten, der erst 1989/90 einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel mitgemacht hat, derzeit möglicherweise sein verlorenes ‚1968‘, einen offenen Generations- und Elitenkonflikt, in dem persönliche Erfahrungen, historische Recherchen und Ansprüche auf Gerechtigkeit sich gegen gängige Wahrheitsansprüche anderer ostdeutscher Erinnerungen positionieren. Wenngleich darin scheinbar eben die liebgewonnenen Erinnerungen der Älteren wieder an politisch-historischer Deutungsmacht gewinnen. Diese aktuelle ‚Ost-Kontroverse‘ verweist damit nicht nur auf einen von Oschmann gern beschworenen West-Ost-Konflikt hin, sondern auch auf innerostdeutsche kulturelle und soziale Brüche, über die hier weiter zu schreiben sein wird.